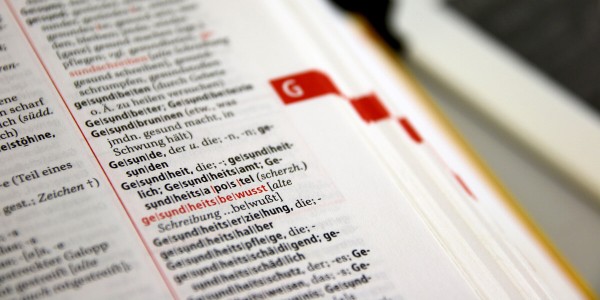Tutzinger Mediendialog
Die (un-)heimliche Macht der Datenkraken
Tutzing / Tagungsbericht / Online seit: 22.12.2016
Von: Miriam Zerbel und Julia Haas
# Medien, Digitalisierung
Download: Tutzinger Mediendialog: Die (un-)heimliche Macht der Datenkraken
Digitalisierung durchdringt fast alle Lebensbereiche. Ganz gleich, ob wir online einkaufen und bezahlen, posten, chatten, mailen oder skypen -in den Datennetzen der Welt sind Informationen über uns gespeichert, die Staat, Wirtschaft oder Geheimdienste nutzen. Aus Alter, Geschlecht, Adresse und Beruf werden Rückschlüsse gezogen auf die Menschen und ihr Verhalten, wird die Entscheidung getroffen, ob Jobs, Kredite und Versicherungsverträge vergeben werden oder nicht. Denkende Kühlschränke, selbstfahrende Autos, lernende Roboterkollegen werden zum Alltag - intelligente Algorithmen berechnen uns.
Geht von Big Data und Data Mining eine Gefahr für die freiheitliche Gesellschaft aus? Kann die Menschenwürde gegen die digitale Revolution verteidigt werden? Brauchen wir eine Ethik der Algorithmen? Das waren nur einige der Fragen, die im Tutzinger Mediendialog gemeinsam mit der Evangelischen Akademie zur Diskussion standen.
„Glauben Sie nichts, was Sie im Internet lesen“, warnte IT-Unternehmerin Yvonne Hofstetter gleich zu Beginn des Dialogs im Tutzinger Schloss. Hofstetter, ist Geschäftsführerin der Teramark Technologies in Freising beschäftigt sich mit Fragen zu den Auswirkungen der Digitalisierung und sieht die Entwicklung kritisch. Die IT-Expertin warnte eindringlich vor intelligenten Maschinen, die in unser Leben eindringen, unsere Freiheit bedrohen und die Basis unserer Demokratie aushebeln.
Wem gehören die Daten?
Hofstetter beschrieb zunächst, wie die Daten erhoben werden. Zahllose Sensoren nicht zuletzt das eigene Handy sammeln demnach eine enorme Menge an Daten, die dann fusioniert werden. Ihre Kritik: die Daten werden nicht kooperativ erhoben. Mit vielen Beispielen unter anderem aus der Gesundheitsbranche untermauerte sie ihre These. So gehören beispielsweise die Daten, die von der Diabetes-Pumpe eines Zuckerkranken erhoben werden, nicht demjenigen, dessen Körper sie erzeugt, sondern dem Pumpen-Unternehmen.
Ein weiteres Problem sieht die Expertin für künstliche Intelligenz darin, dass nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa die Infrastruktur zur Speicherung von Daten fehlt. In den vergangen 20 Jahren seien hier Schlüsseltechnologien verloren gegangen, die nun wichtig wären. Dabei könnte eine sichere Infrastruktur auch ein Wettbewerbsvorteil sein. Das es auch anders geht zeigt das Beispiel der Schweiz: Dort ist eine eigene Infrastruktur für Gesundheitsdaten entstanden. Die Patienten können dort selbst entscheiden, an wen sie die Daten weiterleiten lassen. Zerreibt Big Data Freiheit und Demokratie? Nicht zwangsläufig sagt Hofstetter, die zu den Mitinitiatoren der „Charta der Digitalen Grundrechte der Europäischen Union“ gehört. Ihre Forderung: Technologen müssen Werte in die smarten Produkte einbauen.
„Online-Spielverhalten entscheidet die Bewerbung"
Die Diskussionen über Big Data sind lang, die prognostizierten Gefahren groß. Doch wie werden all unsere Daten gesammelt und welchen Nutzen ziehen die „Datensammler“ daraus? Markus Morgenroth, Informatiker und Berater für Datenschutz, widmete sich diesen Fragen. Seine Antworten erschreckten die Zuhörer: die neue elektronische Zahnbürste, die Schaufensterpuppe oder das Auto, vieles davon ist bereits mit Kameras und Sensoren versehen, um unsere Daten zu sammeln, auszuwerten und für kommerzielle Zwecke zu nutzen. Aus all diesen Informationen könnten Analysen über jeden Einzelnen von uns erstellt werden, die beispielsweise Auskunft über Bildungsniveau, Vertrauenswürdigkeit oder Belastbarkeit geben; Analysen, die auch ein potenzieller Arbeitgeber zu Rate ziehen werde. Die Bewerbungsunterlagen seien dann nur noch zweitrangig, so Morgenroth. Das Problem: keiner hinterfrage diese Daten mehr. Aus der Wahrscheinlichkeit werde die Tatsache. „Wir brauchen mehr Aufklärung und Regeln. Datenschutz muss endlich attraktiv werden“, forderte Morgenroth, der die Hoffnung auf eine Kehrtwende nicht aufgibt; eine Kehrtwende wie es sie einst auch zum Thema Umweltschutz gab.
Vorratsdatenspeicherung statt Informantenschutz?
Daniel Moßbrucker, freier Journalist, hat sich dieser Frage gestellt. 35 Tage lang sammelte Moßbrucker während einer Recherche für die ARD-Börsenredaktion seine hinterlassenen Metadaten und simulierte so das Prinzip der Vorratsdatenspeicherung. Die Dauer eines Telefonates, die Anzahl von Kurznachrichten oder die über GPS gespeicherten Standorte übermittelten zwar keine Inhalte, geben aber ausreichend Auskunft um einen Informanten enttarnen zu können, so der Journalist. Dem Informanten dann noch einen absoluten Schutz garantieren? Für Moßbrucker scheint das zur Farce zu werden. „Das hat nicht nur einen erheblichen Einfluss auf den investigativen Journalismus, sondern schlussendlich auch auf die Pressefreiheit.“
Koevolution eines globalen Supergehirns
Automobile werden zu Big Data-Zentren, Großstädte zu Smart Cities und auch in der Arbeitswelt werde das Internet der Dinge schon bald als Industrie 4.0 Anwendung finden, prognostizierte Professor Kaus Mainzer von der Technischen Universität München. All das veranschauliche die Koevolution eines globalen Supergehirns, in der die Macht von Algorithmen und Big Data zunehme. Mainzer sträubte sich gegen diese Entwicklung zwar nicht, sah aber die Dringlichkeit, die Würde des Menschen in die digitale Welt zu integrieren. „In Zukunft werden Ingenieure auch Humanwissenschaften studieren müssen“, forderte Wissenschaftsphilosoph und Informatiker, um die Digitalisierung im Sinne der Menschenwürde zu gestalten.
Gestaltung der Technologie
Ist Big Data eine Gefahr oder ein Gewinn für die Menschheit? Alles, was wir tun im Netz, hinterlässt Spuren: Jeder bargeldlose Einkauf, jede Bewegung mit dem Handy in der Tasche, jede Anfrage bei Google. Der Google-Hausphilosoph Ray Kurzweil rechnet für das Jahr 2050 damit, dass im Moment der Technologischen Singularität die Maschinen die Menschen überholen. Schadet die Digitalisierung auch der Demokratie? In der abschließenden Podiumsdiskussion in der Evangelischen Akademie ging es vordringlich um Werte im digitalen Zeitalter. Dabei waren sich die Diskutanten einig, dass die Demokratie durch die Allmacht der Algorithmen durchaus Schaden nimmt. Mit Blick auf die aktuellen Erkenntnisse aus dem US-Wahlkampf rund um die so genannten social bots sagte die frühere Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger: „Wenn Informationen bewusst falsch verbreitet werden, dann ist die Meinungsbildung bedroht.“ Der ehemalige Bundesbeauftragte für Datenschutz Peter Schaar, wies darauf hin, dass Datenschutz kein Selbstzweck sei. Zugleich unterstrich Schaar, Technologie ließe sich gestalten und forderte ein Update der Rechtsordnung.
„Wie kann der einzelne die Technologie nutzen, ohne selbst ausgenutzt zu werden? Das wird ein wichtiges Thema im Wahlkampf werden." Sabine Leutheuser-Schnarrenberger Bundesministerin a.D.
Unsicherheit kein Naturgesetz
Ein Appell an die individuelle Verantwortung des Einzelnen greift aber zu kurz. Auch die Unternehmen, die von den Daten profitieren, sollten in den Blick genommen werden, forderte Dr. Thomas Zeiliger, Medienethiker an der Universität Erlangen-Nürnberg. Auf jeden Fall müsse juristische Klarheit herrschen. Dr. Constanze Kurz, Sprecherin des Chaos-Computerclub, kritisierte einen Ideologiewechsel der Bundesregierung hin zu einer Einstellung pro Datenreichtum. Unsicherheit in IT-Systemen sei jedenfalls kein Naturgesetz.
Tweet
@APBTutzing #mediendialog Klaus Mainzer plädiert für Würde im digitalen Zeitalter des "globalen Supergehirns" pic.twitter.com/3bcVc3WRDP
— Thomas Zeilinger (@dilinea) 13. Dezember 2016
Bildergalerie
Flickr-Galerie © Akademie für Politische Bildung Tutzing
News zum Thema
Klicks vor Qualität?
Medien im digitalen Zeitalter
Tagungsbericht, Tutzing, 29.06.2021
© Beate Winterer
Künstlich? Intelligent? Eine Chance oder Gefahr?
Ringvolesung "Künstliche Intelligenz" im Livestream
Tagungsbericht, Nürnberg, 17.04.2020
© TH Nürnberg
Wenn Kollege Roboter die Nachrichten schreibt...
4. Zukunftswerkstatt Radionachrichten
Tagungsbericht, Bremen, 11.02.2020
© Dr. Michael Schröder
Von der analogen zur hybriden Öffentlichkeit
Auswirkungen auf Politik und Gesellschaft
Tagungsbericht, Tutzing, 20.11.2019
© Frederik Haug
Zehntklässler gestalten die Zukunft
Ideenwerkstatt zu Populismus, Propaganda, Plastik und Datensicherheit
Tagungsbericht, Tutzing, 03.06.2019
© Beate Winterer
Die offene Gesellschaft und ihre Gegner
Tutzinger Mediendialog über den radikalen Wandel unserer Kommunikation
Tagungsbericht, Tutzing, 04.12.2018
Foto © APB Tutzing
Die digitalisierte Pflege
Wie die Interaktion zwischen Mensch und Technik einen Berufszweig und die Gesellschaft herausfordert
Tagungsbericht, Schweinfurt, 30.11.2018
Zahlenzauber und Techniktricks
Manipulierte Wahlen
Tagungsbericht, Tutzing, 29.11.2018
Foto © Jörg Siegmund
Sagen, was ist
Auf den Spuren Rudolf Augsteins und anderer Journalisten in der Medien-Metropole Hamburg
Tagungsbericht, Hamburg, 08.11.2018
Foto © Dr. Michael Schröder
Politik, Kommerz und (Un-)Fairplay
Wie kann Sport noch ein gesellschaftliches Allgemeingut bleiben?
Tagungsbericht, Tutzing, 13.10.2018
Foto © APB Tutzing