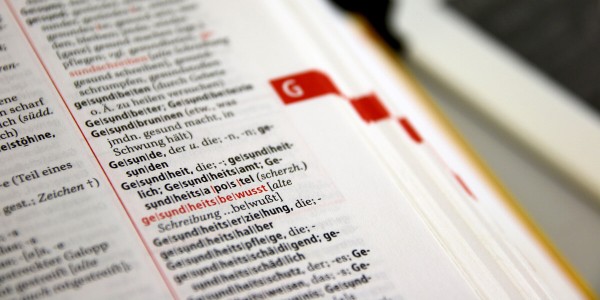Zahlenzauber und Techniktricks
Manipulierte Wahlen
Tutzing / Tagungsbericht / Online seit: 29.11.2018
Von: Sebastian Haas
Foto: Jörg Siegmund
# Demokratie, Parlamente Parteien Partizipation, Digitalisierung, USA, Osteuropa und Russland, Afrika
Download: Zahlenzauber, Techniktricks und verdeckte Einflussnahme
Wahlen und Wahlrecht sind Kernstück der politischen Ordnung, entfalten in repräsentativen Systemen unmittelbare Wirkung auf die Machtverhältnisse, und stehen damit im Fokus legaler wie illegaler Einflussnahme. Wie können Wahlen nachhaltig Legitimationskraft entfalten und demokratische Ordnungen stabilisieren? Darüber haben wir intensiv diskutiert – mit Blick auf Deutschland, die USA und Russland, auf Cyber-Kriminalität und Big Data.
Bildergalerie
Flickr-Galerie © Akademie für Politische Bildung Tutzing
Die Professoren Joachim Behnke (Zeppelin Universität Friedrichshafen) und Eric Linhart (TU Chemnitz) erläuterten Grundlegendes: Wahlen und Wahlrecht sind in repräsentativen Demokratien das zentrale Bindeglied zwischen Wahlbürgern und Volksvertretern. Sie sind Kernstück der politischen Ordnung. Denn mit dem Wahlakt nehmen Bürger ihr Grundrecht und ihre staatsbürgerliche Aufgabe wahr, an der demokratischen Willensbildung mitzuwirken. Sie übertragen mit ihrer Stimme politische Entscheidungskompetenzen an Personen und Parteien. Doch Zugangsregelungen, Sperrklauseln und Auszählmethoden beeinflussen den Wahlausgang ebenso wie Einschüchterungen, Betrug und Cyber-Attacken, Desinformationspolitik und Social-Media-Kampagnen.
Big Data, Algorithmen & Cyber-Attacken
Verschwörungstheorien auf YouTube, Bots auf Twitter, sich selbst radikalisierende Facebook-Gruppen, viel zu laxe Kontrolle für Werbung auf großen Websites und Suchmaschinen - nach den Worten von Patrick Beuth, Redakteur im Ressort Netzwelt von SPIEGEL Online, tobt der Informationskrieg in sozialen Netzwerken in unverminderter Stärke. Dessen Ziel sei es nicht, irgendeiner Partei, einer Kandidatin oder einem Kanditaten zum Wahlsieg zu verhelfen. Es geht vielmehr darum
- Wähler zu demotivieren und eine allgemeine Unzufriedenheit herzustellen;
- Lügen im öffentlichen Diskurs zu verbreiten und zu wiederholen, bis sie im Extremfall als Wahrheiten anerkannt werden (Stichwort: Pizzagate);
- Gesellschaften zu polarisieren und zu spalten;
- das eigene Gesellschaftsmodell letztlich als überlegen darzustellen.
Dass es auch für Profis sichtlich kompliziert ist, mit der großen Menge an fake news, Social Bots und Cyber-Attacken fertig zu werden, betonte auch Gerhard Schabhüser, Vizepräsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik. Beruhigend wirkt da höchstens eine Anmerkung von Patrick Beuth: "Man kann Kampagnen starten, aber ihre Wirkung ist schwer zu messen, und auf die Straße bringen sie nur selten jemanden. Shares und Likes sind eben doch nicht identisch mit politischem Handeln."
Wie Wahlen beeinflusst werden
Das Beispiel USA. Wie Johannes Thimm (Stiftung Wissenschaft und Politik / Goethe-Institut Estland) erläutert, sind die Wahlen dort nur eingeschränkt repräsentativ. Das heutige US-Wahlsystem steht noch ganz in der Tradition der Gründerväter, die dem eigenen Volk nicht ganz über den Weg trauten. Um - und das erscheint derzeit als Ironie der Geschichte - "schlimme", populistische Präsidenten zu verhindern, wurde das System der zwischengeschalteten Wahlleute eingeführt. Dazu kommt das Mehrheitswahlrecht, durch das die Stimmen der Unterlegenen am Ende praktisch nichts mehr Wert sind - und was 2016 dazu führte, dass Donald Trump die Präsidentschaft ohne Mehrheit der Wählerstimmen (popular vote) erringen konnte. Dazu kommt beispielsweise, dass die Durchführung der Wahlen von den Einzelstaaten organisiert wird. Wo eine Partei dominiert, führt das zum sogenannten gerrymandering; vereinfacht gesagt werden Wahlkreise nach deren Vorteil zugeschnitten. Eine deutliche Verzerrung zeigt sich auch mit Blick auf den US-Senat, in dem jeder Bundesstaat zwei Stimmen hat - und mit diesen zum Beispiel 1,5 Millionen Einwohner Idahos, aber auch 40 Millionen Einwohner Kaliforniens vertreten werden.
Die Staaten Afrikas. Alexander Stroh-Steckelberg (Universität Bayreuth) beschrieb die Vielfalt der Wahlen in Afrika und bemerkte grundsätzlich: Die Qualität der Wahlen dort wird stetig besser. Das heißt übrigens nicht, dass demokratisch organisierte Stimmabgaben demokratische Regierungen an die Macht bringen - dafür sind Einschüchterungen und Stimmenkäufe noch zu weit verbreitet. "Wenn wir aber davon ausgehen, dass Demokratien Herrschaftssysteme sind, in denen Regierungsparteien Wahlen verlieren können, hat sich im vergangenen Jahrzehnt viel getan", meint Stroh-Steckelberg und verweist auf die Abwahl von Staatspräsidenten und vermeintlichen Staatsparteien in Gambia, Ghana, Nigeria, Côte d'Ivoire oder Senegal.
Das Beispiel Russland. Sophie Haring (Universität Passau) ist regelmäßig im Auftrag der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) als Wahlbeobachterin unterwegs - und berichtete über den Verlauf der russischen Präsidentschaftswahlen im März 2018. Diese fanden nach Angaben der OSZE in einem überkontrollierten rechtlichen, politischen und medialen Umfeld statt; ununterbrochener Druck auf kritische Stimmen und fehlender Wettbewerb bis hin zur Selbstzensur kennzeichneten den Wahlkampf, und auch die politische Unabhängigkeit der Wahlbehörden kann angezweifelt werden. Der Wahltag war ruhig und geordnet verlaufen. Was der OSZE aber Sorgen bereitete, war zum einen der Druck auf die Bürger und vor allem Staatsbedienstete, ihre Stimmen abzugeben. Zum anderen wurden 13 Prozent der Auszählverfahren negativ bewertet - weil zum Beispiel stumm ausgezählt wurde oder nach Feststellung des Oppositions-Ergebnisses alle weiteren Stimmen dem späteren Wahlsieger Wladimir Putin zugerechnet wurden, ohne auf die ungültigen zu achten.
Und hierzulande?
Doch auch in Deutschland kommt es zu verschiedensten Formen von Wahl(ver)fälschung: sei es durch schlichte Zählfehler, durch verirrte Wahlbriefe oder verdoppelte Wahlbezirks-Ergebnisse. Über Ursachen und Reformvorschläge debattierten Klaus Pötzsch, Pressesprecher des Bundeswahlleiters, Stefanie Schiffer von der European Platform for Democratic Elections (EPDE) und Andreas J. Kohlsche vom Institut für Wahl-, Sozial- und Methodenforschung Ulm.
Weitere Informationen
ZEIT: Die Bundestagswahl kann manipuliert werden
FAZ: Eine Demokratie mit Macken - Gerrymandering in Amerika
Die USA und die transatlantischen Beziehungen - Themendossier der Stiftung Wissenschaft und Politik
News zum Thema
Weltmacht im Alleingang
Donald Trump und die USA im Nahen und Mittleren Osten
Tagungsbericht, Tutzing, 19.12.2018
Die digitalisierte Pflege
Wie die Interaktion zwischen Mensch und Technik einen Berufszweig und die Gesellschaft herausfordert
Tagungsbericht, Schweinfurt, 30.11.2018
Verflixte acht Jahre
Die Entwicklungen nach dem „Arabischen Frühling" kritisch hinterfragt
Tagungsbericht, Tutzing, 28.11.2018
Foto © APB Tutzing
Brückenbauerin über Isar und Atlantik
US-Generalkonsulin Meghan Gregonis zu Besuch in der Akademie
Aus der Akademie, Tutzing, 12.11.2018