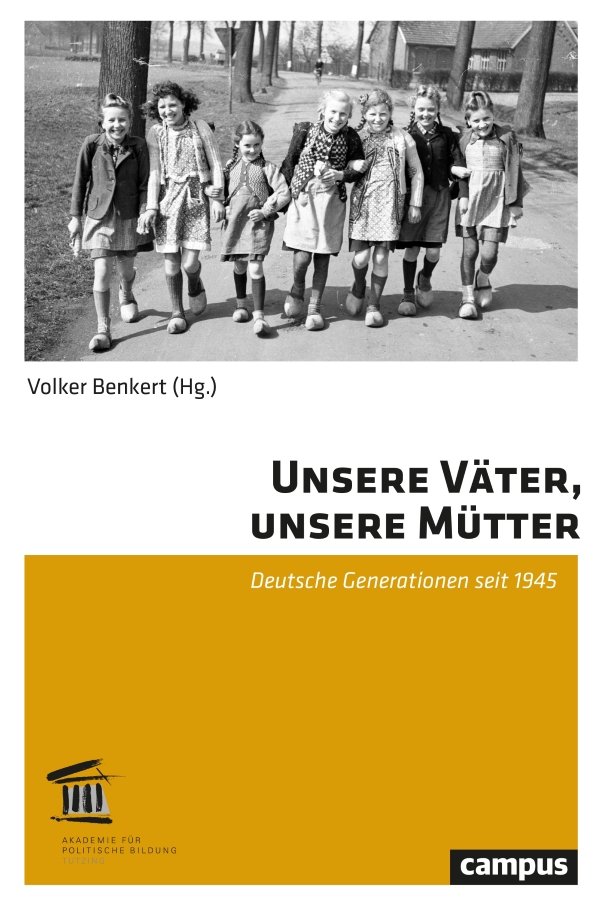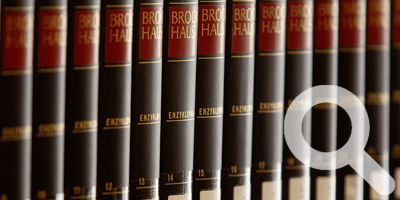Aktuelle Veröffentlichungen
Umbruch, Zerfall und Restauration
Der Nahe Osten im Spannungsfeld regionaler Akteure und externer Mächte
Baden-Baden 2022, Nomos, 279 Seiten
ISBN-13: 978-3-8487-7645-0
[Tagung "Weltmacht im Alleingang. Donald Trump und die USA im Nahen und Mittleren Osten" in Kooperation mit der Technischen Universität Kaiserslautern, 14. bis 16. Dezember 2018 in Tutzing]
Zehn Jahre nach Beginn der Aufstände in der MENA-Region, beleuchtet dieser Band Ursachen, Stand und Perspektiven der Revolten und rückt dabei die Zielsetzungen und Strategien von ausgewählten Akteuren aus der Region (Ägypten, Saudi-Arabien, Israel) sowie von externen Mächten (USA, EU, Russland, Türkei) in den Mittelpunkt, während Syrien und der Iran Querschnittsthemen darstellen. Hierbei steht das Bestreben im Zentrum, das Zusammenspiel von inneren und äußeren Einflussfaktoren freizulegen und auf diesem Wege auch zu zeigen, wie einerseits externe Faktoren sowohl auf die Region als auch einzelne Staaten einwirken und andererseits innenpolitische Faktoren sich in regionalen wie globalen Beziehungsgeflechten und Entwicklungen niederschlagen. Mit Beiträgen von Hakan Akbulut, Elena Dück, Sherin Gharib, Steffen Hagemann, Helmut Krieger, Gerhard Mangott, Anja Opitz, Wolfgang Tönnesmann und Iris Wurm.
Kurztext Details PublikationsbesprechungParteien in Bewegung
Tutzinger Studien zur Politik, Band 20
Baden-Baden 2021, Nomos, 239 Seiten
ISBN-13: 978-3-8487-8461-5
Politische Bewegungen unterschiedlichster Ausrichtung verzeichnen jüngst in vielen Demokratien starken Zulauf und zu Teilen beachtliche Wahlerfolge. Ihre vitale gesellschaftliche Verankerung, ihre beteiligungs- und aktionsfokussierte Organisation, ihre zugespitzte bis populistische Themensetzung scheint für viele Menschen von besonderer Strahlkraft. Damit setzen sie die etablierten Parteien unter Druck, die vielfach als personell, strukturell und inhaltlich wenig attraktiv wahrgenommen werden. Und doch sind und bleiben Parteien in der Demokratie systemrelevant, etwa als verlässliches, dauerhaftes Scharnier zwischen Gesellschaft und staatlichen Institutionen sowie für den demokratischen Wettbewerb um Themen und Konzepte. Die Beiträge in diesem Buch fragen unter anderem, wie es um das Verhältnis von Parteien und Bewegungen bestellt ist und wie die etablierten Parteien mit dem Erwartungs- und Veränderungsdruck umgehen, der aus dem Erfolg des Organisationsmodells »Bewegung« entsteht. Dazu bietet der Band mittels fundierter Analysen Einblicke in Entwicklungen in Deutschland und Europa. Mit Beiträgen von Deniz Anan, Daniela Braun, Sebastian Bukow, Anna-Sophie Heinze, Alexander Hensel, Benjamin Höhne, Uwe Jun, Danny Michelsen, Teresa Nentwig, Jörg Siegmund und Simon Stratmann.
Kurztext Details PublikationsbesprechungMiteinander vor Ort
5. Tutzinger Diskurs
Tutzing 2021, Akademie für Politische Bildung, 86 Seiten
ISBN-13: 978-3-9821033-5-8
[5. Tutzinger Diskurs 2019 bis 2021]
Selbstregierung statt Fremdbestimmung ist das Grundprinzip der Demokratie. Die Grundlage dafür ist umfassende Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Damit jemand selbstregierungsfähig wird, muss ihm immer schon die Fähigkeit zugestanden werden, sich selbst zu bestimmen. Die politische Beteiligung von Jugendlichen soll ihnen die Erfahrung von Selbstwirksamkeit ermöglichen: Was ich will und was ich sage, das macht einen Unterschied und ist nicht gleichgültig. Ziel und Anspruch des Tutzinger Diskurses ist es, kontroverse aktuelle Themen zu erörtern, aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten und Ideen für die Politik zu erarbeiten. Der 5. Tutzinger Diskurs »Integration – Miteinander vor Ort« hatte seit Dezember 2019 das Ziel, zu untersuchen, wie die Beteiligung von Jugendlichen insbesondere in ländlichen Räumen gelingen kann. Die unerwarteten Herausforderungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie mussten in diese Reflexion einfließen.
Kurztext Details PDF-DownloadKranke Kinder haben Rechte!
Bilanz des 1. Deutschen Kindergesundheitsgipfels
Tutzinger Studien zur Politik, Band 19
Baden-Baden 2021, Nomos, 204 Seiten
ISBN-13: 978-3-8487-7791-4
Die Kindermedizin hat in den vergangenen 200 Jahren enorme Erfolge erzielt. Doch in einem Gesundheitssystem, das zunehmend auf Effizienz und Optimierung ausgerichtet ist, werden die Bedürfnisse und Rechte von Kindern oft übergangen. Dazu zählen Aspekte der Krankenhausarchitektur ebenso wie die nötigen Ressourcen, um Kindern die Zeit zu schenken, die sie brauchen. Auch die Begegnung auf Augenhöhe und die Achtung ihrer partizipativen Rechte wird oft vernachlässigt. Im politischen Diskurs und in den Medien finden die Besonderheiten der Kindermedizin ebenfalls kaum Widerhall. Die aktuellen Herausforderungen bei der Behandlung kranker Kinder standen im Fokus des 1. Deutschen Kindergesundheitsgipfels. Vertreter aller deutschen Universitätskinderkliniken diskutierten mit Staatsrechtlern, Ethikern und Experten aus Kinderrechts- und Patientenorganisationen, wie die Situation der Kindermedizin verbessert und kranken Kindern zu ihrem Recht auf eine umfassende Versorgung verholfen werden kann. Der vorliegende Band dokumentiert die auf dem Kongress diskutierten Beiträge. Mit Beiträgen von Thomas Bergmann, Doris Bühler-Niederberger, Stefan Burdach, Klaus-Michael Debatin, Florian Eckert, Benedikt Keil, Christoph Klein, Paul Kirchhof, Thomas Klingebiel, Thomas Lücke, Jörg Maywald, Ursula Münch, Annette Mund, Charlotte Niemeyer, Sabrina Oppermann, Antonia Pelshenke, Annika Reinersmann, Carolin Ruther, Pia Sailer, Helmut Schiffer, Karin Schmidt, Jörg Siegmund und Klaus-Peter Zimmer.
Kurztext Details PublikationsbesprechungGlückliche Niederlage
Warum die CSU froh sein sollte, dass Markus Söder nicht Kanzlerkandidat wurde
Akademie-Kurzanalysen, 1/2021
Tutzing 2021, Akademie für Politische Bildung, 11 Seiten
ISBN-13: 978-3-9821033-4-1
Im Kampf um die Kanzlerkandidatur der Union unterlag CSU-Chef Markus Söder dem Vorsitzenden der CDU Armin Laschet. Dass Söder überhaupt eine Chance hatte, grenzt an ein politisches Wunder. Die Landtagswahl 2018 hatte er mit dem schlechtesten CSU-Ergebnis seit 1950 abgeschlossen. Söder war in Umfragen einer der unbeliebtesten Politiker der Republik und galt als rechter Hardliner. Zufällig hatte Bayern während des Höhepunkts der Coronakrise den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz inne. Söder präsentierte gemeinsam mit Kanzlerin Angela Merkel nach jeder Sitzung medienwirksam die Ergebnisse, pflegte einen besonnenen Stil und einen engen Schulterschluss mit Merkel. Seine Umfragewerte und die seiner Partei schossen nach oben. Erst damit wurde seine Kanzlerkandidatur überhaupt denkbar. Doch für die CSU als Regionalpartei ist die Landtagswahl prinzipiell wichtiger als die Bundestagswahl. Existenziell für seine Partei ist ihr Abschneiden im Land 2023. Deshalb sollte die CSU froh sein, dass ihre Nummer eins jetzt in Bayern bleibt und sich nicht als Regierungschef in Berlin von Kompromiss zu Kompromiss hangeln muss.
Kurztext Details PDF-DownloadKomplexe Farbenlehre
Perspektiven des deutschen Parteiensystems im Kontext der Bundestagswahl 2017
1. Auflage, Frankfurt / New York 2021, Campus, 307 Seiten
ISBN-13: 978-3-593-51032-3
Massive Verluste für CDU/CSU und SPD, die Rückkehr der FDP und der Einzug der AfD in den Bundestag, zähe Koalitionsverhandlungen zwischen September 2017 und März 2018: Die Bundestagswahl von 2017 hat sich tief in die Erinnerung eingegraben. In diesem Band legen Expertinnen und Experten eine Nachlese vor, die neben den Besonderheiten des Wahlkampfs, dem Wählerverhalten und dem Wahlergebnis besonders die Folgen dieser Wahl für das deutsche Parteiensystem in den Blick nimmt. Im Fokus stehen dabei nicht nur die Regierungsbildung und die Positionierung der Parteien in der neuen Legislaturperiode, sondern auch die Einordnung der Entwicklungen aus einer langfristigen Perspektive. Mit Beiträgen von Ulrich Berls, Svenja Boberg, Sebastian Bukow, Frank Decker, Markus Engels, Lena Frischlich, Tim Geiger, Roberto Heinrich, Pablo Jost, Helmut Jung, Elias Koch, Marcus Maurer, Stefan Merz, Daniela Münkel, Gero Neugebauer, Heinrich Oberreuter, Thomas Petersen, Thorsten Quandt, Tim Schatto-Eckrodt, Nico A. Siegel, Jörg Siegmund, Matthias Storath, Bernhard Vogel und Florian Wintterlin.
Kurztext Details PublikationsbesprechungZukunft vor Ort
Kommunalpolitik in Bayern
Hrsg. von der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit und der Akademie für Politische Bildung.
1. Auflage, München 2020, Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, 292 Seiten
„Zukunft vor Ort“ ist das Motto, unter dem Aufsätze und Interviews zu aktuellen Themen der Kommunalpolitik versammelt sind. Die Publikation mit Beiträgen von Expertinnen und Experten konzentriert sich auf die rechtlichen und politischen Grundlagen der Kommunalpolitik, auf ausgewählte Zukunftsvisionen sowie auf die Frage nach Partizipation und Interaktion auf kommunaler Ebene. Gleichzeitig soll der Blick von der „Arbeitsebene“ aus zeigen, wie vielgestaltig und herausfordernd die Arbeit vor Ort in diesen dynamischen Zeiten aussieht. Das Textangebot wird durch Infografiken ergänzt. Die Publikation versteht sich als Angebot, die elementare Basispolitik, die den Alltag der Menschen entscheidend prägt, stärker in den Blick zu nehmen. Sie wendet sich sowohl an Praktiker in der Kommunalpolitik als auch an alle Interessierten. Mit Beiträgen von Diane Ahrens, Siegfried Balleis, Okan Bellikli, Martin Burgi, Monika Franz, Norbert Gebbeken, Max-Emanuel Geis, Florian Gleich, Nobert Göttler, Julia Hacker, Gero Kellermann, Uwe Kranenpohl, Manuel Kronschnabel, Thomas Müller, Ursula Münch, Judith Sandmeier, Angelika Vetter, Paul Warnstedt und Barbara Weishaupt. Interviews mit Wolfgang Glock, Franz Löffler, Christian Bernreiter, Markus Pannermayr und Uwe Brandl.
Kurztext Details PublikationsbesprechungUnsere Väter, unsere Mütter
Deutsche Generationen seit 1945
1. Auflage, Frankfurt / New York 2020, Campus, 246 Seiten
ISBN-13: 978-3-593-50527-5
Was meint der Begriff »Generation«? Ist er durch Zeitumstände geprägt oder wird er im Nachhinein konstruiert? Inwieweit kann Gesellschaftsgeschichte durch den Blickwinkel von Generationen erzählt werden? Wie ist die Beziehung zwischen Generation und Gedächtnis? Wie wird der Begriff um Jugendbewegungen konstruiert? Dieser Band beleuchtet die Zäsuren der deutschen Geschichte seit 1945 durch die von ihnen geformten Generationen: Das Erbe von Weltkrieg und Völkermord, Teilung und Vereinigung spiegeln sich in den jeweiligen Alterskohorten und wurden von diesen unterschiedlich rezipiert. Dabei kommen nicht nur unterschiedliche Altersgruppen in Ost und West zu Wort. Die Autoren stellen auch Grundpositionen der Generationenforschung zwischen generationeller Prägung und nachträglicher Konstruktion einander gegenüber. Mit Beiträgen von Thomas Ahbe, Andreas P. Bechtold, Volker Benkert, Yael Sarah Ben-Moshe, Wulf Kansteiner, Adriana Lettrari-Pietzcker, Benjamin Möckel, Christian Nestler, Jane Porath und Lu Seegers.
Kurztext Details Publikationsbesprechung