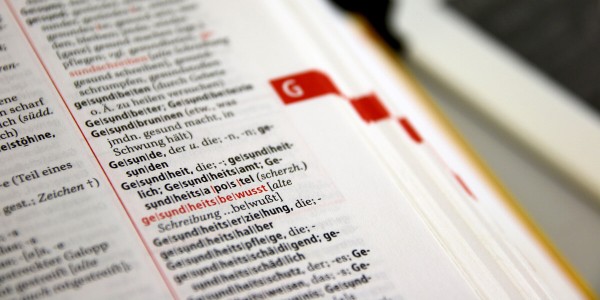Verrat oder Aufklärung?
Die Rolle von Whistleblowern für Demokratie und Medien
Tutzing / Tagungsbericht / Online seit: 25.02.2016
Von: Miriam Zerbel und Michael Schröder
# Medienethik, Ethik
Download: Tutzinger Journalistenakademie: Verräter oder Aufklärer?
Wer Skandale aufdeckt, Hinweise dazu gibt, Alarm schlägt und mehr oder weniger geheime Informationen an die Öffentlichkeit bringt, um Missstände aufzudecken, wird nicht erst seit den Enthüllungen von Edward Snowden als „Whistleblower“ bezeichnet. Aber seit Snowden den NSA-Skandal enthüllte, ist der Begriff auch in den deutschen Sprachgebrauch übergegangen. Häufig zahlen Whistleblower einen hohen Preis, müssen sich als Landesverräter oder als Nestbeschmutzer mit Blockwartmentalität beschimpfen lassen und riskieren nicht selten Beruf, Freundschaften und Familie. Akteure aus Politik, Journalismus und Wissenschaft diskutierten in der Akademie, welche Rolle diese Menschen in einer funktionierenden Mediendemokratie einnehmen und welchen Rechtsschutz sie genießen.
Sind sie Denunzianten oder Informanten? Auch um diese Frage ging es in der Veranstaltung, die in Kooperation mit der Bundeszentrale für politische Bildung und dem Medienhaus Dortmund in der Akademie stattfand. Dass whistleblowing illegal aber zugleich legitim sein kann, machte Professor Johannes Ludwig von der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg deutlich.
Mit und ohne Informantenschutz
Anhand zahlreicher Beispiele wie des ADAC-Skandals mit manipulierten Statistiken veröffentlicht in der Süddeutschen Zeitung oder der gekauften Fußballweltmeisterschaft in Deutschland 2006 von der der Spiegel berichtete, verwies er einerseits auf Whistleblower, die sich an die Medien gewendet haben. Sie handeln zwar juristisch gesehen unrechtmäßig, weil sie den Arbeitsvertrag oder Dienst- und Geschäftsgeheimnisse verletzen beziehungsweise sich nicht an die Loyalitätspflichten halten. Das Bundesverfassungsgericht hat im Rahmen der Güterabwägung dafür eine Regelung geschaffen, die rechtswidriges Handeln legitimiert, wenn ein öffentliches Interesse besteht. Whistleblower unterliegen dann dem Informantenschutz.
„Whistleblowing ist ein elementarer Motor für Qualität und Fortschritt sowie deren permanenter Optimierung. Jedenfalls solange, wie Kritik- und Fehlerkultur nicht selbstverständlich sind.“ Prof. Johannes Ludwig
In weiteren Beispielen zeigte Ludwig Informanten, die zunächst intern versuchten den Missstand anzuprangern wie der Lufthansa-Pilot, der vor kontaminierter Kabinenluft gewarnt hatte. Weil sich diese Menschen aber nicht direkt an die Medien wandten, genossen sie keinerlei Schutz. Und dass obwohl auch ihnen –illegal, aber legitim handelnd- weniger an eigenen Vorteilen, als an der Beseitigung von Missständen gelegen war. Für den gesellschaftlichen Nutzen sei es aber ganz gleich, ob Informanten intern, über die Medien oder andere Wege kommunizieren, so Ludwig. Des Forschers Fazit: „Die rechtliche Situation ist unbefriedigend gelöst.“
Unbeirrte Recherche
Praktische Erfahrungen mit Whistleblowern hat Ulrich Chaussy. Der Radiojournalist vom Bayerischen Rundfunk ist einem größeren Kreis durch seine jahrzehntelangen Recherchen rund um das Oktoberfestattentat in München vom 26. September 1980 bekannt geworden (verfilmt 2013: Der blinde Fleck). Chaussy glaubte nie an die Einzeltäterthese der frühen Ermittlungen. Seine Recherchen führten schließlich dazu, dass der damalige Generalbundesanwalt Harald Range im Dezember 2014 die Wiederaufnahme der Ermittlungen anordnete. Chaussy plädierte für unbedingten Informantenschutz: „Absolute Zurückhaltung und Diskretion empfiehlt sich nicht nur im Interesse der betroffenen Whistleblower. Mit konsequent durchgehaltener Diskretion empfiehlt man sich auch als zuverlässiger Partner. Derjenige investigative Journalist, der die Quelle seiner Informationen preisgibt, wird zum letzten Mal einen Informanten erlebt haben, der sich an ihn wendet."
Chaussy warnte davor, als Journalist in jedem Whistleblower, der sich entsprechend konspirativ mit geheimen, internen und exklusiven Informationen anbietet, einen „edlen Wilden zu betrachten, der uns ausschließlich aus dem lauteren Quell der Wahrheit bedient“: „Vorsicht mit allzu viel blauäugigem Hype um das Whistleblowing. Es ist eine Chance für den Journalismus. Aber auch eine Gefahr. Es ist keine Abkürzung zu schlüsselfertigen Superscoops im Journalismus. Whistleblowing ist vor allem eine Herausforderung zu unbeirrter eigener Recherche.“
Angriff auf Pressefreiheit
Erfahrungen mit Generalbundesanwalt a.D. Harald Range hat auch Markus Beckedahl. Der Chefredakteur von www.netzpolitik.org hatte 2015 zweimal Ausschnitte aus einem als „VS-vertraulich" eingestuften Bericht des Verfassungsschutzes veröffentlicht. Range ermittelte daraufhin gegen Beckedahl wegen Verdachts des Landesverrats (in besonders schweren Fällen bis zu lebenslänglicher Freiheitsstrafe). In der Folge versetzte Bundesjustizminister Heiko Maas Range in den einstweiligen Ruhestand. Die Ermittlungen gegen Beckedahl wurden im August 2015 eingestellt.
In der Vorratsdatenspeicherung und mit dem damit ebenfalls im Kleingedruckten gleich mitverabschiedeten neuen Straftatbestand der „Datenhehlerei" sieht Beckedahl einen „Angriff auf die Pressefreiheit". Sicherer Informantenschutz sei in digitalen Zeiten schwer geworden. Seine Redaktion brauche viel technische Medienkompetenz, um die digitalen Spuren der Recherchen gar nicht erst entstehen zu lassen oder zu verwischen. Digitale Selbstverteidigung gegen die Sicherheitsbehörden sei unerlässlich. Für viele Journalisten und Informanten gebe es keinen ausreichenden Schutz. „Wir brauchen dringend eine zeitgemäße rechtliche Definition, wer als Journalist bezeichnet wird", sagte Beckedahl.
Tweet
Markus #Beckedahl in der @APBTutzing: "Ohne Berichterstattung haben wir keinen Schutz der Öffentlichkeit“ > https://t.co/Klmdy7mc9G #whistle
— drehscheibe (@drehscheibe) 23. Februar 2016
Bildergalerie
Flickr-Galerie © Akademie für Politische Bildung Tutzing
Weitere Informationen
News zum Thema
Die digitalisierte Pflege
Wie die Interaktion zwischen Mensch und Technik einen Berufszweig und die Gesellschaft herausfordert
Tagungsbericht, Schweinfurt, 30.11.2018
Die Audiowende
14. Tutzinger Radiotage: Die Grenzen des Mediums überwinden
Tagungsbericht, Tutzing, 14.09.2018
Foto © Pixabay CC0
Lost in Virtuality?
Chancen und Risiken mobiler Medien bei Jung und Alt
Tagungsbericht, Bayreuth, 12.05.2018
Transplantation, Migration, Gerechtigkeit
Medizinisch-ethische Diskurse in Fragen von Leben und Tod
Tagungsbericht, München, 03.04.2018
Foto © APB Tutzing
Eigene Bedürfnisse und hinnehmbare Unterschiede
Tutzinger Diskurs "Wege der Integration" läuft bis zum Jahresende
Tagungsbericht, Tutzing, 15.01.2018
Foto © APB Tutzing