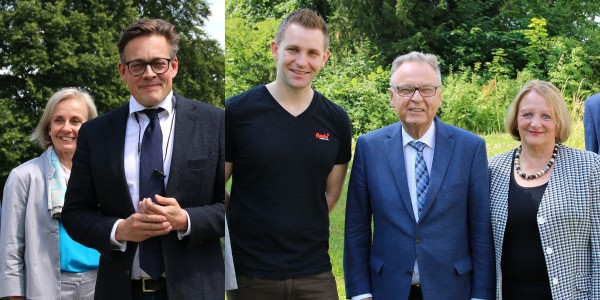Die Zukunft des deutschen Bundesstaates
Verfassungsrechtler und Innenpolitiker debattieren beim Forum Verfassungspolitik über den Föderalismus in Deutschland
Tutzing / Tagungsbericht / Online seit: 02.07.2016
Von: Sebastian Haas und Isabella Zimmer
# Verfassungsfragen
Download: Forum Verfassungspolitik: Die Zukunft des deutschen Bundesstaates
Der Föderalismus in Deutschland steht vor einer Zäsur: Im Jahr 2019 laufen der aktuelle Länderfinanzausgleich sowie der Solidarpakt II aus und damit tragende finanzpolitische Säulen. Ein Jahr danach wird die Schuldenbremse voll verbindlich. Daher stellt sich die drängende Frage, wie die Länder künftig ihre Aufgaben erfüllen können. Um sie zu beantworten, haben wir gemeinsam mit dem ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts Hans-Jürgen Papier zum Forum Verfassungspolitik „Die Zukunft des deutschen Bundesstaates“ in die Akademie für Politische Bildung eingeladen.
Bildergalerie
Flickr-Galerie © Akademie für Politische Bildung Tutzing
So bemerkte der Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts Ferdinand Kirchhof im Einklang mit Hans-Jürgen Papier, dass die Gliederung der Bundesrepublik als Bundesstaat verschiedenartiger Länder von den eigenen Bürgern, der Wirtschaft und der europäischen Politik unzureichend wahrgenommen werde. Dabei biete die bundesstaatliche Gliederung Vorteile wie eine doppelte Legitimation politischer Entscheidungen, die Eigenverantwortung von Ländern, Regionen und Kommunen und somit größere Bürgernähe. Kirchhof sprach sich für eine strenger organisierte Finanzverfassung aus, die heute bestehende Mischfinanzierungen durch Bund und Länder – zum Beispiel beim Küstenschutz oder im Bildungswesen – verringert und so Verantwortliche deutlich benennt. Auch dass der Bund Leistungen versprechen kann, die dann von den Ländern finanziert und durchgeführt werden müssen, sei ein Unding: „Wer bestellt, bezahlt.“ Außerdem forderte Kirchhof ein „radikales Beschneiden des Länderfinanzausgleichs“. Es dürfe kein Cent mehr bezahlt werden als das, was die Lebensfähigkeit der jeweiligen Bundesländer sichere.
Studt und Herrmann: Ein Hoch auf den Föderalismus
Natürlich war der Länderfinanzausgleich auch Thema zweier Innenminister, die sich auf dem Podium der Akademie trafen. Joachim Herrmann (CSU) aus Bayern und sein Amtskollege Stefan Studt (SPD) aus Schleswig-Holstein waren sich einig: Der Föderalismus hat sich bewährt, muss allerdings immer wieder neu verhandelt werden. So haben sich die Länder beispielsweise auf eine Umsatzsteuer-basierte Neuregelung des Finanzausgleichs geeinigt, was der Bundesfinanzminister aber ablehnt. Joachim Herrmann betonte, wie wichtig es sei, gegen „neue zentralisierte Riesenapparate“ in Berlin oder Brüssel vorzugehen und stattdessen auf die Kompetenzen der Länder zu vertrauen. Gerade weil „die Bürger keine Grenzen sehen und spüren wollen“, sei es wichtig, die (grenzüberschreitende) regionale Entwicklung zu stärken, betonte auch Stefan Studt und ergänzte:
Es ist eine große Stärke der 16 Länder, immer zusammenzustehen, wenn es gemeinsam gegen den Bund geht. Stefan Studt, Minister für Inneres und Bundesangelegenheiten von Schleswig-Holstein, mit feiner Ironie.
Zur Föderalismusreform I des Jahres 2006 äußerte sich der Leipziger Professor für Staats- und Verwaltungsrecht Christoph Degenhart vorsichtig positiv. Die inzwischen zehn Jahre zurückliegende Reform war in der Notwendigkeit begründet, den nicht mehr zeitgemäßen Föderalismus Deutschlands zu modernisieren, einen Ausweg aus der „Politikverflechtungsfalle“ zu bieten. Die Reform sei eine pragmatische und vorsichtige gewesen und glückte auch ohne den ersehnten großen Wurf. Schließlich seien, wie Degenhart scherzhaft hinzufügte, Deutschlands Sorgen um den Föderalismus ohnehin ein Luxusproblem angesichts der Schwierigkeiten der Europäischen Union.
Die Europäische Union ist landesblind
Ist das föderale System der Bundesrepublik – in dem theoretisch jede Ebene bei allem mitreden kann – europatauglich? Dieser Frage stellte sich der Staatsrechtler Stefan Korioth von der Ludwig-Maximilians-Universität München. Unbestritten hat die Politik der Europäischen Union großen Einfluss auf die Gestalt des Föderalismus hierzulande, denn europäische Gesetze müssen größtenteils durch die Bundesländer umgesetzt werden. „Die EU kann nur funktionieren, wenn sie landesblind agiert“, so fasst es Korioth zusammen. Das bedeutet seiner Meinung nach aber nicht, dass die Bundesländer ein Verlierer der europäischen Integration sind. Drei Tendenzen sprechen dagegen: Erstens fördert die EU aktiv das Subsidiaritätsprinzip und die Regionen (siehe dazu unseren Tagungsbericht zu Regionalparteien in Europa), zweitens sichert Artikel 79 des Grundgesetzes das Mitspracherecht der Bundesländer, und das drittens im Artikel 23 GG auch in europäischen Fragen.
Tragende Rolle der Kommunen im Bundesstaat
In der abschließenden Podiumsdiskussion erinnerte der Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes Roland Schäfer (SPD) an die Rolle der Kommunen, die viel zu oft in der Föderalismusdebatte außen vor gelassen würden. Dabei seien sie der erste Vermittler zwischen Bund und Bürgern. Auch Hans-Jürgen Papier bekräftigte, wie wichtig starke Länder und Kommunen für eine lebendige und lebenswerte Demokratie sind. Außerdem waren sich die Podiumsteilnehmer darüber einig, dass es einer besseren Bund-Länder Kooperation bedürfe, die dem Föderalismus nicht nur neuen Aufschwung gebe, sondern auch bei brisanten Themen wie der Flüchtlingskrise zu besseren Ergebnissen führen kann. Es fehle, meint Schäfer, ein effizientes Verteilernetz, das beispielsweise einen direkteren Dialog zwischen Bund und Kommunen ermöglichen kann.
Bayern im deutschen Föderalismus
Sowohl der I. Vizepräsident des Bayerischen Landtages Reinhold Bocklet als auch der Präsident des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs München Peter Küspert legten ihr Augenmerk hauptsächlich auf das Land Bayern – mit seiner historisch geprägten, soliden Identität und somit föderalen Verantwortung in Deutschland. Während Bocklet das Subsidiaritätsprinzip eher als einen Rückschritt des Deutschen Föderalismus betrachtete, sah Küspert in den Föderalismusreformen und in der steigenden Europäischen Integration der letzten Jahre zumindest keine Veränderung des Gewichts der Bayerischen Verfassung. Dennoch steht ganz Deutschland vor immer wachsenden Herausforderungen, mit denen der Bundesstaat nur anhand von einer effizient reformierten Aufgabenteilung fertig werden wird.
Weitere Informationen
Föderalismus in Deutschland - ein Online-Dossier der Bundeszentrale für politische Bildung
News zum Thema
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
Episode 26 unseres Podcasts mit Gero Kellermann
Podcast, Tutzing, 18.12.2023
© APB Tutzing
Russlands Verbrechen in der Ukraine
Gerhart Baum über die Aktualität der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
Tagungsbericht, Tutzing, 28.11.2023
© Amelie Wimmer
Das Verhältnis von Staat und Kirche in der Zukunft
Deutschland will Kirchensteuer und Staatsleistungen ablösen
Tagungsbericht, Tutzing, 20.07.2023
© Almagul Shamyrbekova
Das Krisenszenario eines Blackouts
Wie sicher sind Stromversorgung und Gasversorgung in Deutschland?
Tagungsbericht, Tutzing, 21.03.2023
© Pauline Wanner
Die neuen Dimensionen von Sicherheit
Forum Verfassungspolitik zu Gesundheit, Klimaschutz, Energiesicherheit und Cybersicherheit
Tagungsbericht, Tutzing, 11.01.2023
© Sara Ritterbach Ciuró
Mein Smartphone, das unbekannte Wesen
Wo verläuft die Grenzen zwischen Freiheit und Sicherheit im Digitalen?
Tagungsbericht, Würzburg, 17.09.2018
Foto © APB Tutzing
,,Zum Geburtstag keine Blumen!"
Symposium zur Verfassungspolitik zum 75. von Hans-Jürgen Papier
Tagungsbericht, Tutzing, 14.07.2018
Foto © Sebastian Meyer
Die ge-hack-te Demokratie?
Grundrechte und Digitalisierung beim Forum Verfassungspolitik / Mit Konstantin von Notz, Max Schrems, Hans-Jürgen Papier und Sabine Leutheusser-Schnarrenberger
Tagungsbericht, Tutzing, 30.06.2018
Foto © APB Tutzing
Bürgernah und entscheidungsstark?!
Landesparlamente im politischen Wettbewerb
Tagungsbericht, Tutzing, 28.04.2018
Foto © APB Tutzing
Transplantation, Migration, Gerechtigkeit
Medizinisch-ethische Diskurse in Fragen von Leben und Tod
Tagungsbericht, München, 03.04.2018
Foto © APB Tutzing