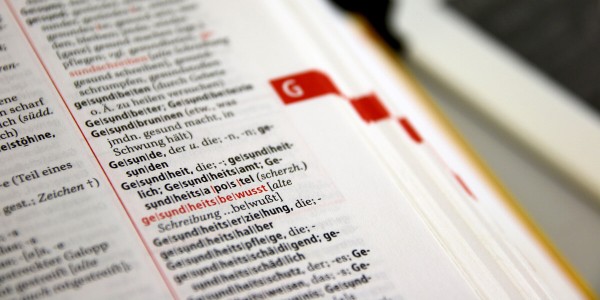Freiheitsrechte im Fadenkreuz
Wie gefährdet ist die Demokratie in Ungarn? Diskussion mit Budapester Professor Hansen und ungar. Generalkonsul Tordai-Lejkó
Tutzing / Tagungsbericht / Online seit: 21.09.2016
Von: Sebastian Haas
Foto: Rodefeld via VisualHunt.com / CC BY
# Religion, Ethik
Der Vorschlag des luxemburgischen Außenministers Jean Asselborn, Ungarn wegen schwerer Verstöße gegen die europäische Werteordnung mindestens zeitweise aus der Europäischen Union auszuschließen, mag wenig durchdacht gewesen sein, brachte aber eines in Erinnerung: die Regierung Orbán schottet Ungarn vor Flüchtlingen ab, schränkt in ihrem Land die Pressefreiheit ein und schlägt häufig rechtspopulistisch-nationalistische Töne an. Wie steht es also um die Demokratie in Ungarn?

Diskutierten über die politische Lage in Ungarn: Prof. Dr. Hendrik Hansen von der deutschsprachigen Andrássy Universität Budapest (links) und der ungarische Generalkonsul in München, Gábor Tordai-Lejkó (Foto: Haas).
Darüber diskutierten der ungarische Generalkonsul in München, Gábor Tordai-Lejkó, und der Politikwissenschaftler Prof. Dr. Hendrik Hansen von der deutschsprachigen Andrássy Universität Budapest mit Akademiedirektorin Prof. Dr. Ursula Münch. Mit dabei waren 70 interessierte Zuhörer und Fragesteller, die zum großen Teil aus der Tutzinger Kommunalpolitik kamen. Denn das Akademiegespräch am See „Freiheitsrechte im Fadenkreuz – Wie gefährdet ist die Demokratie in Ungarn?“ fand im Vorfeld der Tutzinger Jubiläumsfahrt nach Balatonkenese statt. Seit 20 Jahren besteht die Partnerschaft mit der Gemeinde am Plattensee – eine Delegation macht sich im Oktober vom Starnberger See auf den Weg nach Ungarn.
Zunächst kein Bruch mit der kommunistischen Vergangenheit
Hendrik Hansen erläuterte zunächst die Bedingungen, unter denen die Regierung Orbán 2010 ihre Arbeit aufgenommen hatte: in einem Land, in dem die alten sozialistischen Eliten nach 1989 ihre Macht in die Wirtschaft (!) verlagert hatten, in dem die Verbrechen des Kommunismus nie wirklich aufgearbeitet wurden, in dem die Parteien zerstritten und die wirtschaftlichen Nöte groß sind (dazu die FAZ im Herbst 2006 zu den Folgen der „Lügenrede“ des damaligen sozialistischen Regierungschefs Gyurcsány). So trat Viktor Orbán mit einer Zweidrittelmehrheit der Parlamentssitze für seine Fidesz-Partei an, um die „verhandelte Revolution“ von 1989 endlich zu vollenden und schnell eine neue Verfassung zu verabschieden – angetrieben, betonte Generalkonsul Tordai-Lejkó, durch die große Unzufriedenheit in der Bevölkerung und vorbereitet bereits während der ersten Fidesz-Regierung von 1998 bis 2002.
Von Fidesz durchgepeitscht: Das neue Grundgesetz
Das Grundgesetz Ungarns aus den Jahren 2011/12 ist in vielerlei Hinsicht umstritten: es schränkt die Befugnisse des Verfassungsgerichts ein, hat einen expliziten Nationen-, Gottes- und Familienbezug und erlaubt der Regierung Strafmaßnahmen gegenüber den Medien (viele dieser Bedenken zusammengefasst in diesem ZEIT-Beitrag von 2011). Nicht schön, aber nicht ganz so wild, meint Hendrik Hansen:
- der Gottes-, Familien und Nationenbezug im Grundgesetz sei eine legitime Position im europäischen Spektrum und wurde zudem von zwei Dritteln der Wahlberechtigten bestätigt;
- das Mediengesetz diene vor allem dem Schutz vor Falschdarstellungen; zudem sei in kaum einem europäischen Land die Situation für die Medien so angenehm wie in Deutschland, wo der öffentlich-rechtliche Rundfunk vor dem inhaltlichen Einfluss aus der Politik geschützt ist; für den Qualitätsverlust und Niedergang der traditionellen ungarischen Medien jedenfalls kann Viktor Orbán nicht verantwortlich gemacht werden.
Polarisierung, Populismus und Homogenität
Insgesamt macht Hendrik Hansen vier akute Probleme in der ungarischen Politik aus:
- Eine starke Polarisierung der Parteien, in der ein Minimalkonsens über grundlegende Werte und Verfahren unmöglich ist. Zudem kommt keine vernünftige Kontrolle der Regierung zustande, weil die größte Oppositionspartei, die rechtsextreme Jobbik, das politische System grundsätzlich ablehnt und die verbliebene grüne und sozialistische Opposition parlamentarisch sehr schwach ist.
- Ein ausufernder Populismus vor allem in Bezug auf Migrationspolitik und die Europäische Union.
- Ein identitäres Demokratieverständnis Viktor Orbáns: er setzt nicht auf Vermittlung zwischen verschiedenen Meinungen, sondern auf Homogenisierung und das vermeintliche Recht der Mehrheit.
- Eine problematische Geschichtspolitik, innerhalb derer Ungarn allein als Opfer europäischer Politik interpretiert wird. So lässt sich die Diskussion über Verbrechen während des Zweiten Weltkriegs und im Kommunismus einfach auf die persönliche Ebene verlagern – und auch heute kann man sich leicht als Opfer der Politik aus Brüssel darstellen.
Der ungarische Generalkonsul Gábor Tordai-Lejkó stimmte der Schlussfolgerung des Politikwissenschaftlers zu: statt innerhalb der Europäischen Union unliebsame Meinungen und Personen (ob mit oder ohne Regierungsverantwortung) zu stigmatisieren, müssten diese wieder diskutiert und das Verständnis von Pluralismus erneuert werden. „Steuerdumping und unfairer Wettbewerb scheinen ja auch nicht im Widerspruch mit der europäischen Werteordnung zu stehen“, erklärte Hansen mit Verweis auf den Vorschlag des luxemburgischen Außenministers, Ungarn wegen schwerer Verstöße gegen eben diese zumindest zeitweise aus der Europäischen Union auszuschließen.
Tweet
Diskussion zur #Demokratie in #Ungarn (mit Hansen, Münch, Opitz, Tordai-Lejkó): #Orbán für vieles verantwortlich, aber nicht für alles. pic.twitter.com/5FFslbUWjT
— APB Tutzing (@APBTutzing) 21. September 2016
News zum Thema
Die digitalisierte Pflege
Wie die Interaktion zwischen Mensch und Technik einen Berufszweig und die Gesellschaft herausfordert
Tagungsbericht, Schweinfurt, 30.11.2018
Transplantation, Migration, Gerechtigkeit
Medizinisch-ethische Diskurse in Fragen von Leben und Tod
Tagungsbericht, München, 03.04.2018
Foto © APB Tutzing
Eigene Bedürfnisse und hinnehmbare Unterschiede
Tutzinger Diskurs "Wege der Integration" läuft bis zum Jahresende
Tagungsbericht, Tutzing, 15.01.2018
Foto © APB Tutzing
Mein Körper, meine Daten?
Tutzinger Diskurs „Big Data" beginnt / Projekt läuft in den kommenden zwei Jahren
Tagungsbericht, Tutzing, 25.11.2017
Alles Lüge?
Medien, Wahlkampf und Populismus
Tagungsbericht, Tutzing, 23.10.2017
Foto © Pixabay CC0 / eigene Collage