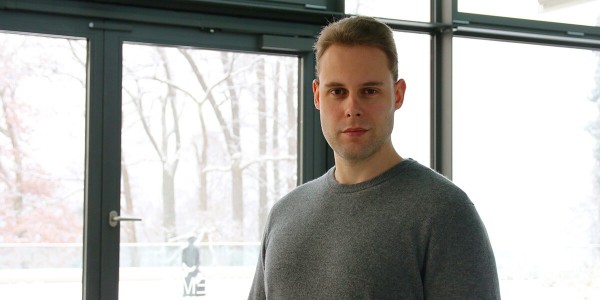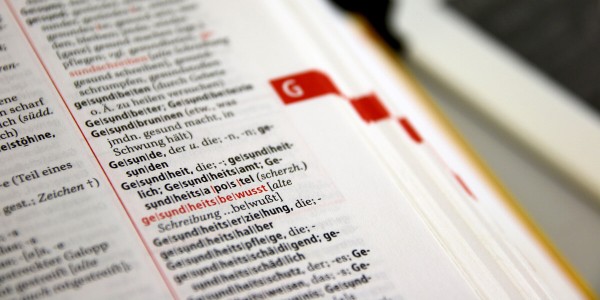(Un-)Fair Play?
Sport und Politik
Tutzing / Tagungsbericht / Online seit: 23.02.2016
Von: Miriam Zerbel
# Ethik
Schimpf, Schande und Skandale prägen die Sportberichterstattung in jüngster Zeit. Ganz gleich, ob es um die Verstrickung von FIFA und DFB in Korruptionsvorwürfe geht oder um kriminelle Machenschaften im Internationalen Leichtathletikverband, um staatlich gelenktes Doping oder die Vergabepolitik bei sportlichen Großveranstaltungen. Sport als Machtinstrument ist anfällig für Missbrauch. Sport als gesellschaftliches Ereignis erscheint vielen als moderner Religionsersatz, der eine hohe Aufmerksamkeit generiert. Gerät darüber der Breitensport ins Hintertreffen? Die Frage, wie Sport ein gesellschaftliches Allgemeingut bleiben kann, diskutierten Sport-Experten in der Akademie für Politische Bildung aus unterschiedlichen Blickwinkeln.
In seinem Eröffnungsvortrag provozierte der investigative Sportjournalist Jens Weinreich mit der Feststellung: „Betrug und Manipulation bei sportlichen Großereignissen gehören zum Alltag.“ Detailreich und akribisch zeigte er kriminelle Machenschaften und Netzwerke auf.
„Dammbruch verändert Weltsport“
Eine historische Zäsur sieht der Sportjournalist in der Festnahme zahlreicher FIFA-Funktionäre Ende Mai vergangenen Jahres in einem Schweizer Luxushotel. „Das war ein Dammbruch, seitdem ist vieles anders im Weltsport.“ Den Enthüllungen in den Medien und dem entschlossenen Handeln von Bürgern und Justiz ist es laut Weinreich zu verdanken, dass die Sache ins Rollen gekommen ist und nun auch erstmals die Schweizer Justiz ermittelt.
Stein des Anstoßes ist für den Journalisten die undurchschaubare Organisation von FIFA und IOC , die sich auf zahllose, intransparente Geschäftsbeziehungen gründet. Ein Franchisesystem mit Knebelverträgen und Staatsbürgschaften führt demnach zu einer „Kultur des Schweigens“ , in der Geschädigte lieber nicht vor Gericht gehen und mit Geld abgefunden werden. Als Beispiel führte er unter anderem ein Qualifikationsspiel zur Fußball Weltmeisterschaft 2010 zwischen Frankreich und Irland an. Irland habe von der FIFA Geld erhalten , damit es trotz eines Regelverstoßes nicht vor Gericht geht.
Dass die Weltverbände als Monopolisten keinerlei Wettbewerb unterliegen, kritisierte der Sportexperte ebenso wie die Größenordnung des Schadens durch Korruption. Allein der gerichtlich dokumentierte Schmiergeldstrom beläuft sich demzufolge auf 142 Millionen Schweizer Franken. Weinreich, der bei der FIFA als persona non grata gilt, sieht aber nicht nur im Fußball und beim IOC Probleme. Gang und gäbe sei in vielen anderen Sportverbänden beispielsweise das Freikaufen bei Doping. Dagegen kontert er:
Sport ist nur sinnvoll, wenn er echt ist. Jens Weinreich
Wie sich Zivilgesellschaften durch Sport entwickeln können, machte Professorin Heather Cameron, von der Freien Universität Berlin am Beispiel Afghanistan und Südafrika deutlich. Sowohl das Volleyball-Projekt für Mädchen in Afghanistan als auch das Boxgirls-Projekt in Südafrika wirkt auf drei Ebenen: auf die Gesellschaft, beispielsweise im Sinne einer ökonomischen Teilhabe, auf die lokale Gemeinschaft, indem die Ausbildungschancen steigen und auf das einzelne Individuum mit verbesserter Gesundheit und Bildungschancen.
„Wichtig ist: was machen wir mit dem Sport?“, erklärt Cameron. Auch wenn sich in Afghanistan die Mädchen mangels Turnhallen einen Luftballon im Klassenzimmer zupritschen, geht es darum, den Spaß zu fördern, damit die Begeisterung für Sport ankommt. Voraussetzung dafür ist, dass die Schule ein sicherer Ort ist. Ein generelles Problem ist hingegen die Wirkungsmessung von Projekten wie Boxgirls. Zu hoch gehängte Erwartungen versucht Cameron auf den Boden zu holen: „Sport bringt nicht den Frieden in die Welt.“
Kindern Chancen verschaffen
Sportliche Großereignisse wirken sich vor allem in Schwellen- und Entwicklungsländern auf die örtliche Bevölkerung aus. Häufig gehen Olympische Spiele oder Weltmeisterschaften auf Kosten von Kindern und Jugendlichen vor Ort. Mit dem Projekt childrenwin dokumentiert und analysiert Dr. Marianne Meier von Terre des Hommes die Auswirkungen auf die Altersgruppe der bis zu 18-Jährigen. Sie verfolgt das Ziel, das Risiko von Kindern aus armen Familien zu minimieren und die Chancen, die sich durch Megaveranstaltungen wie Fußball-Weltmeisterschaften durchaus ergeben, zu maximieren. Ferner sollen neue Standards für Vergabe und Durchführung bei den Verantwortlichen durchgesetzt werden. Mithilfe einer konsequenten Kommunikationsstrategie und durch Allianzen und Kooperationen auch mit lokalen Partnern, zeigt childrenwin positive und negative Effekte auf, die vor, während und nach den Sportveranstaltungen entstehen.
Wir geben den Kindern eine Stimme. Dr. Marianne Meier
Wichtig sei vor allem hinzuschauen, was nach Großereignissen passiere, ob beispielsweise dann der Strom abgestellt werde oder die Maßnahmen zur Reinhaltung der Luft plötzlich nicht mehr greifen. Dennoch warnte sie vor einer Art Ablasshandel von IOC und FIFA nach dem Motto: „Wir machen zwar Fehler, aber durch die Unterstützung guter Projekte waschen wir uns rein.“
Sport dient auch als Projektionsfläche. „Was zählt, ist auf dem Platz“, trifft eben nicht mehr ausschließlich zu. Diese Verknüpfung von sportlichen und außersportlichen Interessen nahm Professor Jürgen Mittag von der Deutschen Sporthochschule Köln unter die Lupe. Solche Proteste treten aus verschiedenen Motivationen und in unterschiedlichsten Formen auf, meist situativ und punktuell, ganz gleich ob sich in Hamburg Olympiabefürworter und –gegner streiten oder die Fans von Borussia Dortmund mit Tennisbällen im Stadion gegen Preiserhöhungen protestieren: Es geht darum einen Widerspruch zu artikulieren, einen Missstand zu beheben und vor künftigen Fehlentwicklungen zu warnen. Gemeinsam ist fast allen Protesten das Bemühen, öffentliche Aufmerksamkeit zu wecken, Zustimmung zu finden und mögliche Unterstützer für das eigene Anliegen zu mobilisieren.
In der aktuellen Debatte zeigt sich dem Wissenschaftler zufolge das Spannungsfeld zwischen Ignoranz, Solidarisierung und Boykott, zwischen der Hoffnung, über den Sport Aufmerksamkeit zu generieren und der Kritik an den Kosten für Megasportevents. Die mediale Nachhaltigkeit von sportlichen Großereignissen sei allerdings minimal, kritisiert der Forscher. „Der Protest verebbt, wenn der Ball auf dem Platz rollt."
Tweet
Ich dachte, dass ich viel über Thema FIFA und IOC weiß. Aber nach dem Vortrag von @JensWeinreich ist es eine ganz neue Welt. @APBTutzing
— Vankó Lázár Bence (@lazarbencevanko) 19. Februar 2016
Bildergalerie
Flickr-Galerie © Akademie für Politische Bildung Tutzing
News zum Thema
Unser neuer Akademie-Philosoph
Simon Faets leitet den Bereich Theoretische und Ethische Grundlagen der Politik
Aus der Akademie, Tutzing, 15.02.2021
© Beate Winterer
Integration als Teilhabe
Neue Publikation aus der Reihe Tutzinger Studien zur Politik
Publikation, Tutzing, 01.10.2020
© Pixabay License/Gerd Altmann
Die Pandemie in der Philosophie
Episode 10 unseres Podcasts mit Roberta Astolfi
Podcast, Tutzing, 17.06.2020
© APB Tutzing
Ethik in der künstlichen Intelligenz
Neue Technologien human gestalten
Tagungsbericht, Tutzing, 15.03.2020
© Beate Winterer
Digitalisierung im Gesundheitswesen
Kommt die Therapie bald per App?
Tagungsbericht, Tutzing, 15.11.2019
© Natalie Weise
Die digitalisierte Pflege
Wie die Interaktion zwischen Mensch und Technik einen Berufszweig und die Gesellschaft herausfordert
Tagungsbericht, Schweinfurt, 30.11.2018
Transplantation, Migration, Gerechtigkeit
Medizinisch-ethische Diskurse in Fragen von Leben und Tod
Tagungsbericht, München, 03.04.2018
Foto © APB Tutzing
Eigene Bedürfnisse und hinnehmbare Unterschiede
Tutzinger Diskurs "Wege der Integration" läuft bis zum Jahresende
Tagungsbericht, Tutzing, 15.01.2018
Foto © APB Tutzing
Mein Körper, meine Daten?
Tutzinger Diskurs „Big Data" beginnt / Projekt läuft in den kommenden zwei Jahren
Tagungsbericht, Tutzing, 25.11.2017
Alles Lüge?
Medien, Wahlkampf und Populismus
Tagungsbericht, Tutzing, 23.10.2017
Foto © Pixabay CC0 / eigene Collage