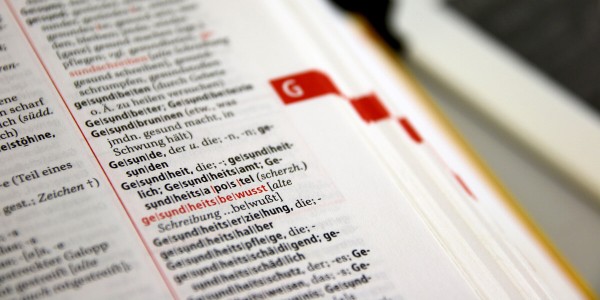Dialog mit dem Dagegenbürger?
Herausforderungen und Strategien der politischen Kommunikation
Tutzing / Tagungsbericht / Online seit: 27.05.2016
Von: Christine Petrus und Sibylle Kölmel
Politische Entscheidungsträger glauben vermehrt rückwärtsorientierten Dagegenbürgern entgegenzustehen, Bürger fühlen sich von Führungseliten in Politik und Wirtschaft nicht ernst genommen. Der Dialog wird verkürzt, pointiert und birgt noch mehr Potenzial zur Aufwiegelung und Entrüstung. Das plakative Statement avanciert zum Grundpfeiler des (post)modernen Dialogs, die politische Kommunikation steht vor dem Scheitern. Kommunizieren Politiker und Bürger tatsächlich aneinander vorbei? Überfordert der Druck zur ständigen Kommunikation die politischen Systeme? Oder umgekehrt: Welche Chancen birgt die neue Kommunikationskultur fürs demokratische Regieren? Diese Fragen haben wir bei unserer Fachtagung diskutiert.
Bildergalerie
Flickr-Galerie © Akademie für Politische Bildung Tutzing
Den Eröffnungsvortrag hielt Prof. Dr. Thomas Leif. Der Chefreporter vom SWR Fernsehen Mainz sprach über Inszenierungspartnerschaften zwischen Politik und Medien - „Inszenierung ist aus Sicht der Politik eine Reaktion auf die Nichtbeachtung der normalen Alltagsaufgaben, des zähen Politikgeschäfts." Aus Sicht der Medienmacher suggeriert die Politik selbst, dass Politik die Bürger nicht zu interessieren habe und am Publikum vorbeiginge. Die Folge: Eine Misstrauens-Kultur auf Seiten der Politiker und der Medienschaffenden. „Inszenierung ist eine Antwort auch auf die Inkompetenz der Medien, mit einem kurzen Wording kommen die Politiker einfach mehr durch.“ Es gelte dann häufig das Prinzip des „Oneliners“, einer Aussage, – dann nämlich müssen die Medienschaffenden nehmen, was sie bekommen und können es nicht noch weiter kürzen. Die Inszenierung dieser Art werde zunehmend angenommen – und folge mehr, so Leif, Regeln des Eventmarketings und der Werbung. Die Folge: die Kommunikation, wie Politik vermittelt wird hat grundlegend ihren Wesenskern verändert.
Georg Streitner, stellvertretender Regierungssprecher der Bundesregierung, sprach über die Praxis der Kommunikation der Bundespolitik, insbesondere ging er auf die Bereiche der Entscheidungs- und Darstellungspolitik ein. Die Menschen zeigten eine pauschale Ablehnungshaltung gegen politische Entscheidungen. Es bestehe die Gefahr, dass soziale Medien immer mehr als Sprechrohr der Unzufriedenen dienen, die sich dem Diskurs von vornherein verweigern. Es stellt sich aber auch die Frage: soll man wirklich mit allen Gruppen in Dialog treten? Gerade bei gezielt gestreuten Falschinformationen ist Vorsicht geboten, weil man diese im schlimmsten Fall womöglich sogar aufwertet. Nichtsdestotrotz stelle auch die Nichtkommunikation eine Art der Kommunikation dar. Politik brauche einen geschützten Raum, um ungestört reflektieren zu können und die Meinungsbildung anzuregen. Streiters Handlungsempfehlungen für die Politik sind: die Menschen ernstnehmen, komplexe Sachverhalte nicht unnötig verkomplizieren, Lösungskonzepte mit Bedacht zu erstellen und Freiraum zur Reflexion zu fördern.
Der Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland, Richard Kühnel, beschäftigte sich mit der Vermittlung von Europapolitik. Das Vertrauen in die Politik Europas sei auch durch externe Effekte erschüttert worden. Dennoch werden zugleich hohe Erwartungen an die europäische Politik gestellt. Problematisch sei vor allem, dass 500 Millionen Bürger aus Brüssel regiert werden und die nationale Politik immer mehr in den Hintergrund gerät, sich aber auch immer mehr selbst zurückzieht. Man müsse jedoch beachten, dass das EU-Parlament nicht als vollwertiges Parlament anerkannt wird und stark dem Vorwurf des Zentralismus und der Intransparenz ausgesetzt sei. Besonders die Stärkung der repräsentativen Demokratie sei wichtig, denn die Angst der Bürger darf nicht zum Treiber der Politik werden.
Hans-Joachim Bues als Leiter des Konzernbereichs Unternehmenskommunikation der Flughafen München GmbH vermittelte einen Einblick in die Unternehmens-kommunikation bei Großprojekten am Beispiel der Planung einer dritten Start- und Landebahn. Der Flughafen München, der von drei staatlichen Anteileignern gehalten wird, habe versucht die Bevölkerung frühzeitig einzubinden und das Vorhaben transparent darzulegen. Bues äußerte Verständnis für die kritische Betrachtung von Großprojekten, jedoch mahnte er auch, dass einzelne Bürger Nutzen und Vorteile von Großprojekten nur in geringem Umfang individuell nachvollziehen können. Staatliche Verbesserungen in der Infrastruktur und Nachfragestruktur dienten letztendlich den Bürgern.
Dana Manescu, Head of Sector Social Media, Directorate-General for Communication European Commission berichtete über den Einsatz von Social Media in der EU. Insbesondere bemängelte die Referentin, die Gefahr des Ausschlusses bestimmter Bevölkerungsgruppen durch Social Media und die mangelnde Rückbindung zu den Nutzern. Paul F. Nemitz, Director for Fundamental Rights and Union Cititzenship, Directorate-General for Justice European Commission beschäftigte sich mit der Frage, ob und wie sich Hetze im Internet besser kontrollieren lasse und welche Möglichkeiten es gibt diese zu unterbinden. Hauptprobleme seien der schmale Grat zwischen Zensur und dem Recht auf freie Meinungsäußerung, oder was es bedeuten würde, wenn nationale Parlamente bei der Regelung des Internet keinen Beitrag mehr leisten würden. Prof. Dr. Christoph Neuberger, Direktor des Instituts für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung der Ludwig-Maximilians-Universität München widmete sich der drohenden digitalen Spaltung: bietet die virale Kommunikation der Öffentlichkeit mehr Zugangs- und Beteiligungschancen? Seine Schlussfolgerung: es komme sehr wohl zu einer digitalen Spaltung, einem Zerfall der Öffentlichkeit und einer Verrohung des Diskurses.
Beim Akademiegespräch am See unter dem Motto „Europäische Legitimitätskrise – eine Kommunikationskrise?“ diskutierte Dr. Franz Fischler, Präsident des Europäischen Forums Alpbach, Bundesminister a.D. und EU-Kommissar a.D. aus Wien mit Professor Werner Weidenfeld, der Direktor des Centrums für angewandte Politikforschung (C·A·P) der Ludwig-Maximilians-Universität München. Franz Fischler diagnostizierte der Europäischen Union eine Unfähigkeit zur Kommunikation. Die Mitgliedstaaten hätten keinerlei Interesse, der Europäischen Kommission die Kommunikationshoheit zuzugestehen. Hinzu kommt, meint Fischler, dass „das, was die EU an Möglichkeiten hat in puncto Kommunikation, sehr papiern, sperrig in der Sprache, nicht zeitgemäß, bescheiden und träge ist“. Information werde mit Kommunikation verwechselt, die Weitergabe von Information sei „top-down“ geregelt – und der Bürger könne wenig Kritik direkt äußern. Für Werner Weidenfeld führt das Phänomen Europa auch den wohlmeinenden Bürger zur Nachdenklichkeit und das Zeitalter der Komplexität zum häufigeren Nichtverstehen von Sachverhalten und so zu Konfusion, Verängstigung und Vertrauensschwund – und das auch bei existentiellen Herausforderungen wie der Flüchtlingskrise. „Wir leben in einer Misstrauensgesellschaft. Und zum ersten Mal verbindet sich das Misstrauen mit einer Sinnkrise.“ Eine Neuentwicklung sei, dass die Empörungsangebote der Politik (an die Medien) immer schärfer werden. Der Aufreger ist Praxis, die Empörungswelle ist in Produktionspraxen der Medien integriert.
Unsere Tagung "Dialog mit dem Dagegenbürger? Herausforderungen und Strategien der politischen Kommunikation" war eine Kooperation mit der Vertretung der Europäischen Kommission in München.
Tweet
Wie mit dem #Wutbürger umgehen? In der @APBTutzing gabs eine Tagung dazu - die wichtigsten O-Töne hier: https://t.co/Z5utp6R0S7
— Heinrich R. Bruns (@hrbruns) 25. Mai 2016
Weitere Informationen
Richard Kühnel - Vertretung Europäische Kommission in Deutschland
Gary Schaal - Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg
Rudolf Korte - Universität Duisburg-Essen
Christoph Neuberger - Freie Universität Berlin
Werner Weidenfeld - Direktor des C·A·P und Professor für Politische Wissenschaft an der LMU München
News zum Thema
Osteuropa, EU und NATO
Tagung zur geopolitischen Bedeutung der Region
Einladung, Tutzing, 23.04.2024
© iStock/Michele Ursi
Psychische Belastungen nach Auslandseinsätzen der Bundeswehr
Ausstellung "Gesichter des Lebens" porträtiert Soldatinnen und Soldaten
Kultur, Tutzing, 19.04.2024
© Beate Winterer
Die kritischen Infrastrukturen Wasser und Verkehr
Tagung zu Zukunft und Sicherheit
Einladung, Tutzing, 15.04.2024
© iStock/wmaster890
Die kritischen Infrastrukturen Wasser und Verkehr
Tagung zu Zukunft und Sicherheit
Pressemitteilung, Tutzing, 15.04.2024
© iStock/wmaster890
Bodenschutz und Landwirtschaft
Der scheinbare Konflikt zwischen Klimapolitik und Ernährungssicherheit
Tagungsbericht, Tutzing, 12.04.2024
© Beate Winterer
Weltmacht im Alleingang
Donald Trump und die USA im Nahen und Mittleren Osten
Tagungsbericht, Tutzing, 19.12.2018
Frische Akzente, zukunftsträchtige Werte
Werte-Botschafter, eine Staatssekretärin und ein Rapper mit Geschichte(n) in der Akademie
Tagungsbericht, Tutzing, 10.12.2018
Foto © Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus
Zerreißproben
Europäische Integration, Stabilisierung der Eurozone, Zuwanderung und Integration - Schwerpunkt im Akademie-Report 4/2018
Akademie-Report, Tutzing, 05.12.2018
Die offene Gesellschaft und ihre Gegner
Tutzinger Mediendialog über den radikalen Wandel unserer Kommunikation
Tagungsbericht, Tutzing, 04.12.2018
Foto © APB Tutzing
Die digitalisierte Pflege
Wie die Interaktion zwischen Mensch und Technik einen Berufszweig und die Gesellschaft herausfordert
Tagungsbericht, Schweinfurt, 30.11.2018