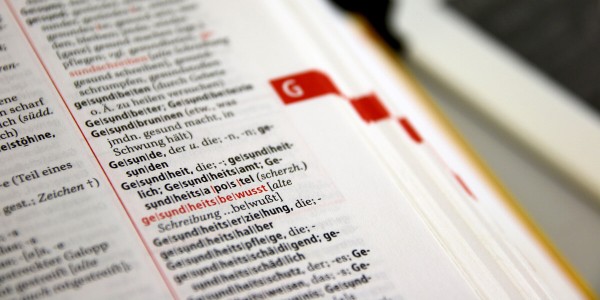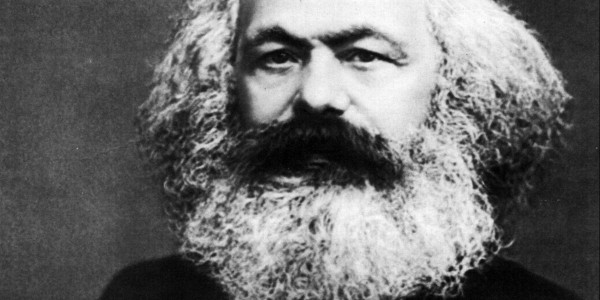Armut und Reichtum in der Demokratie
Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten fragt nach Konsequenzen sozialer Ungleichheit für Politik und Politische Bildung
Tutzing / Tagungsbericht / Online seit: 25.11.2015
Von: Sebastian Haas
# Politische Bildung, Sozialstaat
Download: Armut und Reichtum in der Demokratie: Wie wollen wir zusammen leben?
Bildergalerie
Flickr-Galerie © Akademie für Politische Bildung Tutzing
Willkommen zuhause. Die Jahrestagung des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten (AdB) – 1959 in unserem Hause gegründet – zum Thema „Armut und Reichtum in der Demokratie“ griff die Debatte um die ungleiche Verteilung von Einkommen und Vermögen in Deutschland auf. Dieser Unterschied wirkt sich auf die Gestaltungs- und Chancengleichheit hierzulande aus, und damit auf das demokratische System. Welchen Beitrag die politische Bildung vor diesem Hintergrund für den Zusammenhalt der Gesellschaft und die Zukunftsfähigkeit der Demokratie leisten kann, war die zentrale Frage dieser Tagung.
Zu Beginn erläuterte Judith Niehues vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln anhand vieler Daten die Entwicklung von Armut und Reichtum in Deutschland. So können die Personen, die hierzulande von Armut bedroht sind – jeder siebte Bürger –, holzschnittartig als alleinstehend, alleinerziehend, jünger als 25, ostdeutsch und/oder arbeitslos beschrieben werden. Wer wenig verdient, schätzt seine finanzielle Lage aber tendenziell besser ein, als sie wirklich ist, während die Gutverdiener pessimistischer argumentieren. Übrigens lässt sich die tatsächliche Einkommensverteilung in Deutschland grafisch anhand eines Kreisels beschreiben: wenige sehr arme, eine breite Mitte, wenige in der absoluten Spitze. Die sogenannte Einkommensschere hat sich darüber hinaus seit ungefähr zehn Jahren nicht weiter gespreizt.
Soziale Ungleichheit als Problem für die Demokratie
Diese Sicht bestätigte Professor Michael Hartmann (ehemals Technische Universität Darmstadt) – betonte aber, dass sich zwischen 1980 und 2005 die Einkommen und Vermögen der Reiche(re)n immens vervielfacht hätten. Hartmann zeichnete ein Bild einer von den Interessen der oberen Zehntausend dominierten Polit- und Meinungslandschaft. Von steigenden Bruttoeinkommen und der Steuerpolitik profitieren demnach Vorstandvorsitzende, Aufsichtsräte, Anteilseigner und Steuerfüchse, die wiederum die soziale Ungleichheit im Land nicht als drängendes politisches und gesellschaftliches Problem erkennen. So verwundert es kaum, dass sich alle anderen zunehmend vom politischen Geschehen abwenden.
Was politische Bildung tun kann
Zahlen und Daten wie diese können in verschiedene Richtungen interpretiert werden – und so diskutierte Judith Niehues gemeinsam mit Ulrich Eith, dem Leiter des Studienhaus Wiesneck, und Moritz Kilger von der Europäischen Jugendbildungs- und Begegnungsstätte Weimar zur Frage: Wieviel Armut und wieviel Reichtum verträgt die Demokratie? Deutlich wurde an den Ausführungen der Podiumsteilnehmer: Der deutsche Sozialstaat steht nicht vor einem revolutionären Umbruch, und auch der politischen Bildung kann es nicht darum gehen, die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse nach dem Prinzip reiner Umverteilung von Reich zu Arm zu propagieren. Vielmehr muss die politische Bildung Diskussionen über die Grundlagen des globalen Wirtschaftssystems und des hiesigen Sozialstaats sowie über den Sinn von Wohlstand fördern – gerade mit denen, die scheinbar von diesen Systemen benachteiligt werden. „Das Interesse an den geniun politischen Fragen des gesellschaftlichen Zusammenlebens ist da“, stellte Moritz Kilger fest, „doch die Ansprache durch die politischen Institutionen ist bisher mangelhaft.“
In parallelen Workshops hatten die Besucher der AdB-Jahrestagung außerdem die Gelegenheit, bestimmte Aspekte von Armut und Reichtum in der Demokratie mit der politischen Bildungsarbeit zu verbinden:
- Wohin mit dem Geld? Engagement für politische Bildung durch private Stiftungen (mit Mattias Fiedler von der Bewegungsstiftung Verden)
- Bildung als Schlüssel gegen Armut – Was kann politische Bildung erfolgreich dazu beitragen? (mit Gerti Wolf vom Internationalen Bund, Frankfurt a. M.)
- Ansprache benachteiligter Zielgruppen für politische Bildung (Mark Kleemann-Göhring von der Universität Duisburg-Essen)
Tweet
Willkommen zuhause! Jahrestagung des Arbeitskreises dt. Bildungsstätten (hier gegründet am 9.9.59). pic.twitter.com/UUzizqTdQe
— APB Tutzing (@APBTutzing) 24. November 2015Weitere Informationen
Das Themenportal zu Einkommen und Vermögen beim Institut der deutschen Wirtschaft
News zum Thema
Die digitalisierte Pflege
Wie die Interaktion zwischen Mensch und Technik einen Berufszweig und die Gesellschaft herausfordert
Tagungsbericht, Schweinfurt, 30.11.2018
Hatte Marx doch Recht?
Soziale Ungleichheit in Deutschland und Europa
Tagungsbericht, Lichtenfels, 26.11.2018
Brückenbauerin über Isar und Atlantik
US-Generalkonsulin Meghan Gregonis zu Besuch in der Akademie
Aus der Akademie, Tutzing, 12.11.2018
Unermüdlich kreativ
Michael Spieker verlässt die Akademie und wird Professor in Benediktbeuern
Aus der Akademie, Tutzing, 04.10.2018
Politische Bildung in Zeiten des Populismus
Zur Wirkung in einer Ära der Polarisierung, Verrohung und fake news
Tagungsbericht, Tutzing, 06.09.2018
Foto © Pixabay CC0 / eigene Collage